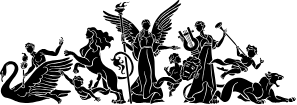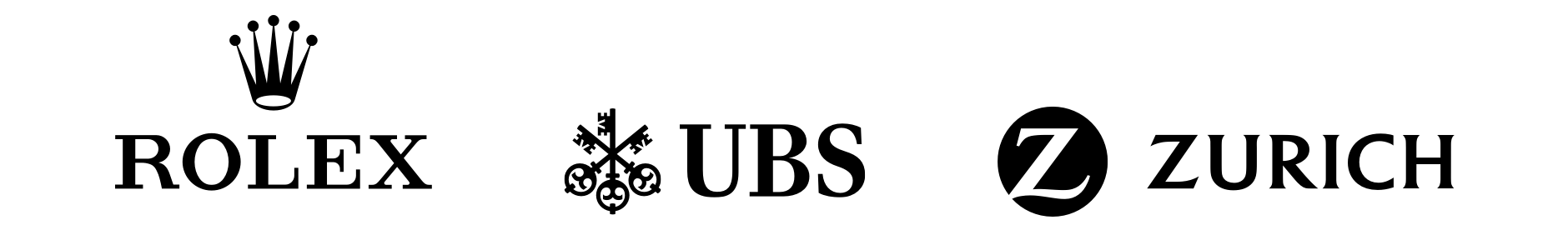Für Ihre Spende bedanken wir uns mit besonderen Einblicken in die Welt des Kontrafagotts.
Ab 150 CHF
Für alle Spenden ab 150 CHF bedanken wir uns auf Wunsch gerne mit einer namentlichen Nennung auf unserer Webseite www.opernfreunde.ch.
Ab 2500 CHF
«Stimmen aus dem Graben»: Sie erhalten eine Einladung zum Gesprächskonzert im Spiegelsaal mit der Kontrafagottistin Elisabeth Göring und dem Orchesterdirektor Heiner Madl. Neben Anekdoten aus dem Orchesteralltag und der Vorstellung des neuen Instruments erwartet Sie ein Konzert, in dem das Kontrafagott musikalisch im Mittelpunkt steht. Im Anschluss gibt es natürlich auch einen feinen Apéro, bei dem Sie die Möglichkeit haben, alle Beteiligten kennenzulernen. Der Anlass findet am Samstag, 11. April 2026 um 16.00 Uhr im Spiegelsaal statt. Als Spender:in dürfen Sie die Veranstaltung in Begleitung besuchen.
Ab 4000 CHF
«Mittendrin im Orchester!»: Sie und Ihre Begleitung werden zu einer exklusiven Orchesterprobe eingeladen und sehen das Kontrafagott aus der Nähe und im Einsatz. Es sind zwei Termine vorgesehen, aus denen Sie einen auswählen dürfen.
Erster Termin: Für Sie öffnen wir die sonst geschlossene Generalprobe für das 3. Philharmonische Konzert unter der Leitung der Dirigentin Elim Chan. Auf dem Programm steht unter anderem Maurice Ravels «Ma Mère l’Oye», eine Vertonung mehrerer Märchen. In der Orchesterfassung stellt das Kontrafagott das Biest aus «Die Schöne und das Biest» dar. Sie erleben den wohl wichtigsten solistischen Einsatz für Kontrafagott in der symphonischen Literatur. Der Anlass findet am Samstag, 10. Januar 2026, um 11.00 Uhr statt.
Zweiter Termin: Sie sind bei der Orchesterprobe zum 6. Philharmonischen Konzert unter der Leitung von Maestro Gianandrea Noseda mit dabei. Sie nehmen neben der Fagottgruppe Platz und erleben das Instrument in Aktion – insbesondere beim Feinschliff für Sergej Prokofjews Suite aus dem Ballett «Romeo und Julia». Der Termin ist am Donnerstag, 19. März 2026, um 19.00 Uhr.
Für 12'000 CHF
«Hauskonzert – Musik direkt in Ihr Wohnzimmer»: Zum ersten Mal bringt das Orchester der Oper Zürich Musik direkt zu Ihnen nach Hause – ein echtes Novum! Die Orchesterdirektion stellt ein speziell für Sie kuratiertes musikalisches Programm mit Mitgliedern des Orchesters der Oper Zürich zusammen. Sie stellen die Location, wir bringen die Musik! Der Termin erfolgt nach Absprache mit der Geschäftsstelle bei Katherine Waldvogel.
Hinweis: Für Ihre Spende stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus. Der Betrag ist gemäss kantonalen Steuergesetzen absetzbar.